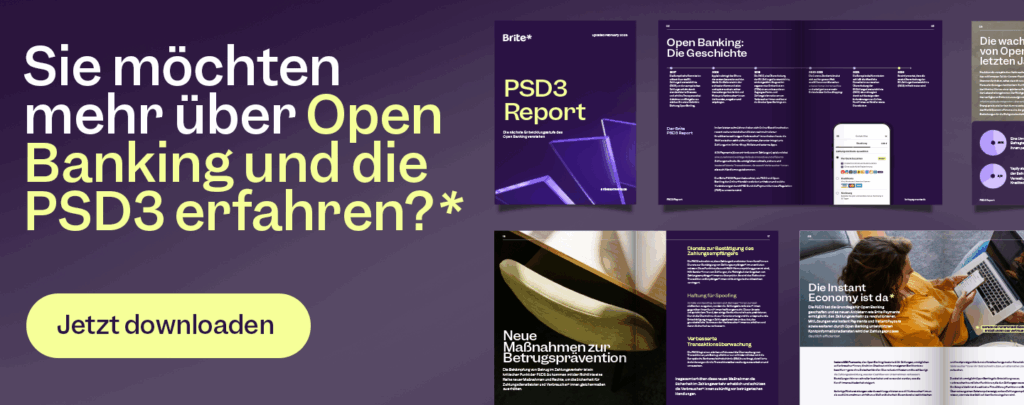EU-Regulierung 2026
— Ein Überblick
Erfahren Sie, welche regulatorischen Neuerungen den Zahlungsverkehr im Jahr 2026 prägen werden und wie Sie sich vorbereiten können.

Auf den europäischen Finanzsektor kommen wichtige Neuerungen zu. In den nächsten zwei Jahren werden neue Vorschriften den Rahmen für Zahlungen, Compliance und digitale Identitäten neu definieren.
Von Instant Payments im Rahmen der Instant Payments Regulation über strengere Anti-Geldwäsche-Vorschriften und Meldepflichten für Kryptowerte bis hin zur Einführung der European Digital Identity (EUDI) – die regulatorischen Anforderungen steigen weiter an.
Das Jahr 2026 wird für Finanzinstitute, Unternehmen und Zahlungsdienstleister von zentraler Bedeutung sein. Der Fokus liegt dabei auf der praktischen Umsetzung der Vorgaben, die gleichzeitig neue Innovationsimpulse setzen und zu einem transparenteren Finanzökosystem beitragen.
In diesem Beitrag analysieren wir die EU-Regulierungen im Zahlungsverkehr, die 2026 im Fokus stehen. Wir zeigen auf, worauf sich Institute vorbereiten müssen, um die Anforderungen zu erfüllen.
Instant Payments Regulation (IPR)
Die Instant Payments Regulation (IPR) zielt darauf ab, die Nutzung und den Einsatz von Instant Payments bzw. Echtzeitüberweisungen in den Mitgliedstaaten der EU zu fördern. Obwohl die Verordnung bereits im April 2024 in Kraft getreten ist, markiert das Jahr 2026 einen wichtigen Meilenstein: Im April steht die erste verpflichtende Berichterstattung für Zahlungsdienstleister (PSPs) an.
Die IPR verpflichtet Zahlungsanbieter, die in der EU operieren und Transaktionen in Euro abwickeln, Instant Payment Services für Transaktionen anzubieten. Damit müssen Zahlungen zwischen Bankkonten innerhalb von Sekunden abgewickelt werden – und das rund um die Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen. Die Gebühren für Instant Payments dürfen dabei nicht höher sein als die für traditionelle Überweisungen. Banken und PSPs müssen zudem eine robuste Betrugsprävention sowie eine IBAN-Namensprüfung (Verification of Payee) implementieren, um Fehler und Betrugsversuche zu reduzieren.
Bis 2026 werden die meisten Banken der Eurozone in der Lage sein, Instant Payments zu senden und zu empfangen. Der Fokus verschiebt sich dann auf die regulatorische Aufsicht: Zahlungsdienstleister müssen Berichte über Serviceverfügbarkeit, Akzeptanzraten und Compliance erbringen. Die Europäische Kommission und die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) nutzen diese Daten, um Fortschritte zu überwachen, Engpässe zu erkennen und die Durchsetzung zu steuern.
Für Unternehmen verbessern Instant Payments den Cashflow und die Liquidität, während Verbraucher*innen von schnelleren und bequemeren Transaktionen profitieren. Die Verordnung standardisiert zudem den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr und fördert so Wettbewerb und Innovation.
Wichtige Termine und Fristen
- 8. April 2024: Inkrafttreten der Instant Payments Regulation (IPR)
- 9. Januar 2025: Banken im Euroraum müssen Instant Payments empfangen können.
- 9. Oktober 2025: Banken und PSPs im Euroraum müssen Instant Payments senden können.
- April 2026: Erste verpflichtende Berichterstattung an Aufsichtsbehörden zu Serviceverfügbarkeit, Akzeptanz und Compliance.
- 9. Januar 2027: Banken außerhalb des Euroraums müssen Instant Payments empfangen können.
- 9. Juli 2027: Zahlungsanbieter außerhalb des Euroraums und Nichtbanken-PSPs (E-Geld-/Zahlungsinstitute) müssen Instant Payments senden können.
Ausblick
Mit der ersten verpflichtenden Berichterstattung im April 2026 verschiebt sich der Fokus von der Einführung zur Überprüfung der IPR. Für Zahlungsdienstleister ist dies ein relevanter Stichtag, der zugleich die Basis für neue Angebote im Bereich Echtzeit-Zahlungen bildet. Ziel der Verordnung ist es, Instant Payments als sicheren und kosteneffizienten Standard im europäischen Zahlungsverkehr zu etablieren.
Payment Service Directive 3 (PSD3)
Die Payment Services Directive 3 (PSD3) treibt die Modernisierung des europäischen Zahlungsverkehrs entscheidend voran. Der Vorschlag der Europäischen Kommission baut auf der PSD2 auf und zielt darauf ab, den Verbraucherschutz, die Zahlungssicherheit und die Innovation im Zahlungsverkehr weiter zu verbessern.
Das Europäische Parlament und der Europäische Rat haben den Vorschlag geprüft und jeweils eigene Entwürfe vorgelegt. Derzeit arbeiten die drei Organe (Trilog) an einer politischen Einigung; eine endgültige Version wird im ersten oder zweiten Quartal 2026 erwartet. Sobald die Richtlinie verabschiedet ist, beginnen die Mitgliedstaaten mit der Umsetzung in nationales Recht.
Die PSD3 setzt im Vergleich zur PSD2 wichtige neue Impulse. Die Richtlinie verschärft nicht nur die Anforderungen an das Risikomanagement, sondern erhöht auch die Transparenz für Verbraucher*innen. Sie schafft gezielt Anreize für neue Zahlungsmethoden und den Ausbau von Open-Banking-Diensten. Zudem definiert die PSD3 die Verantwortlichkeiten von Drittanbietern (TPPs) präziser und stärkt die Befugnisse der Aufsichtsbehörden, um aktiv gegen Cyber-Bedrohungen vorzugehen.
Im Kern schafft die PSD3 die notwendigen Voraussetzungen für einen faireren Wettbewerb und klare rechtliche Spielregeln. Dies dient als Grundlage, um die nächste Generation sicherer und innovativer Zahlungsdienste in Europa zu fördern.
Wichtige Termine und Fristen:
- Q1-Q2 2026: Erwartete endgültige politische Einigung (Trilog-Abschluss).
- Nach Verabschiedung (ab 2026): EU-Mitgliedstaaten beginnen mit der Umsetzung der PSD3 in nationales Recht.
- 2026-2027: Finanzinstitute, FinTechs und PSPs bereiten die Anpassung von Systemen, Risikomanagement und Compliance-Frameworks vor.
- Nach nationaler Umsetzung: Die PSD3-Verpflichtungen (u.a. erweiterter Verbraucherschutz, Open-Banking-Support, Cybersicherheit) werden rechtsverbindlich.
Ausblick
Nach der voraussichtlichen Finalisierung der PSD3 Anfang 2026 beginnt die Umsetzung in nationales Recht. Damit startet für Banken und Zahlungsanbieter die Implementierungsphase, in der Systeme und Compliance-Prozesse an die neuen Vorgaben angepasst werden müssen. Die effiziente Umsetzung der Anforderungen an Risikomanagement, Verbraucherschutz und Open Banking wird dabei die künftige Wettbewerbsposition der Institute beeinflussen.
eIDAS 2.0
Die eIDAS 2.0-Verordnung transformiert die digitale Identität in Europa: Sie führt das European Digital Identity (EUDI) Wallet ein und definiert damit die digitale Nachweisführung neu. Das Wallet ermöglicht es Bürger*innen und Unternehmen, offizielle Dokumente, Identitätsinformationen und Nachweise sicher zu speichern und für eine Vielzahl von öffentlichen und privaten Dienstleistungen zu nutzen.
Ein wichtiger Meilenstein ist der November 2026: Bis dahin müssen alle EU-Mitgliedstaaten ihren Bürger*innen und Unternehmen mindestens ein voll funktionsfähiges und zertifiziertes EUDI-Wallet zur Verfügung stellen. Diese Frist sorgt dafür, dass die digitalen Identitätslösungen EU-weit reibungslos funktionieren. So wird der nahtlose Zugang zu Dienstleistungen in allen Mitgliedstaaten Realität.
Die Einführung der EUDI-Wallets soll das Vertrauen in die digitale Identität stärken, den Zugang zu Dienstleistungen vereinfachen und ein sichereres, nutzerfreundlicheres digitales Ökosystem fördern.
Wichtige Termine und Fristen
- November 2026: Alle EU-Mitgliedstaaten müssen Bürger*innen und Unternehmen mindestens eine voll funktionsfähige, zertifizierte EUDI-Wallet bereitstellen.
- Ab November 2026: Mitgliedstaaten und Dienstleister müssen dafür sorgen, dass die Wallets EU-weit funktionieren und an Behörden sowie private Unternehmen angebunden werden können.
Ausblick
Mit Ablauf der Frist im November 2026 werden EUDI-Wallets flächendeckend eingeführt, was den digitalen Zugang zu Dienstleistungen vereinheitlicht. Für Unternehmen und Behörden geht die Anforderung über die bloße Verfügbarkeit hinaus: Entscheidend ist die technische Integration der digitalen Identitäten in bestehende Systeme. Dies umfasst die Anbindung relevanter Prozesse, vom Onboarding bis zur Transaktionsfreigabe.
Das EU-Geldwäschepaket
Das EU-Geldwäschepaket stellt die umfassendste Überarbeitung des europäischen Rahmenwerks zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) seit über einem Jahrzehnt dar.
Das im Juni 2024 veröffentlichte Paket umfasst drei zentrale Bestandteile:
- Die 6. Geldwäsche-Richtlinie: Eine Richtlinie über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung.
- Die Geldwäsche-Verordnung: Eine Verordnung zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung.
- Die europäische Anti-Geldwäsche-Behörde: Eine Verordnung zur Errichtung einer neuen EU-Behörde (Anti-Money-Laundering Authority, kurz: AMLA) mit Sitz in Frankfurt am Main.
Diese Maßnahmen zielen darauf ab, einen einheitlichen Rechtsrahmen zur Geldwäschebekämpfung innerhalb der EU zu schaffen. Die Reformen weiten die AML-Pflichten auf Dienstleister für Krypto-Assets (CASPs), Händler von Luxusgütern und Immobilienfachleute aus. Gleichzeitig stärken sie die Transparenz der wirtschaftlichen Eigentümer und verbessern den Zugang der Behörden zu Finanz- und Immobiliendaten.
Wichtige Termine und Fristen
- 1. Juli 2025: Die AMLA nahm ihre Arbeit auf und begann mit der Festlegung technischer Standards.
- 10. Juli 2026: Die Mitgliedstaaten müssen die zentralen Vorschriften zu den Registern der wirtschaftlichen Eigentümer gemäß der 6. Geldwäsche-Richtlinie umsetzen.
- 10. Juli 2027: Die Geldwäsche-Verordnung tritt vollständig in Kraft, und die Mitgliedstaaten müssen alle Aspekte der 6. Geldwäsche-Richtlinie umgesetzt haben.
Ausblick
Bis 2026 werden die AMLA und die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) detaillierte technische Standards veröffentlichen, die den Beginn der operativen Phase des neuen EU-Geldwäschepakets markieren. Finanzdienstleister, Händler von Luxus- und Kulturgütern sowie Krypto-Anbieter sollten diese Zeit nutzen, um ihre Compliance-Systeme zu überprüfen, Know Your Customer (KYC)-Prozesse anzupassen und ihre Customer Due Diligence (CDD) zu stärken.
Meldepflicht für Kryptowerte (DAC8)
Die Achte Richtlinie zur Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden (DAC8) schließt eine der größten Transparenzlücken im digitalen Finanzwesen. Mit Inkrafttreten am 1. Januar 2026 unterwirft sie Dienstleister für Krypto-Assets (CASPs) – wie Krypto-Börsen oder Wallet-Anbieter – erstmals die gleichen strengen Meldepflichten, die für traditionelle Banken bereits (unter CRS/DAC2) gelten.
Konkret müssen CASPs die steuerliche Ansässigkeit ihrer Kund*innen ermitteln, überprüfen und melden. Als zentrales Werkzeug dient dabei die Steueridentifikationsnummer (TIN), ergänzt durch Stammdaten wie Adresse und Geburtsdatum.
Der Name der Richtlinie “Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden” ist dabei Programm: Nationale Steuerbehörden sind verpflichtet, diese Daten automatisch auszutauschen. Dies ist nicht nur eine Erlaubnis, sondern der Kernzweck der Richtlinie: Sie stellt sicher, dass Krypto-Vermögen und -Transaktionen dem korrekten Steuerpflichtigen im Ansässigkeitsstaat zugeordnet und Steuerhinterziehung effektiv verhindert werden.
Die Richtlinie setzt den globalen OECD-Standard (CARF) in EU-Recht um und aktualisiert parallel den Common Reporting Standard (CRS), um Krypto-Assets und digitale Währungen (wie E-Money und CBDCs) konsistent zu erfassen.
- 1. Januar 2026: DAC8 tritt in Kraft; CASPs müssen mit der Erfassung und Überprüfung der Kundensteuerdaten beginnen.
- 30. Juni 2027:Erste Berichte für das Finanzjahr 2026 (Transaktionen und Kundeninformationen) sind fällig.
Ausblick
Ab dem 1. Januar 2026 gelten neue Standards für die steuerliche Erfassung von Krypto-Assets. Dies erfordert von Anbietern eine Anpassung ihrer Compliance-Strukturen. Im Fokus stehen die systematische Ermittlung steuerlicher Kundendaten sowie die technische Bereitstellung der Meldewege.
Leitlinien der EBA zu Sanktionen
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat neue Leitlinien für das Management der Umsetzung von Sanktionen eingeführt, die am 30. Dezember 2025 in Kraft treten. Diese Leitlinien stärken den EU-Rahmen für Finanzsanktionen, indem sie sicherstellen, dass Finanzinstitute in der gesamten EU einen konsistenten, risikobasierten Ansatz zur Identifizierung, Verhinderung und Meldung von Sanktionsverstößen anwenden.
Als Reaktion auf zunehmende geopolitische Spannungen und die wachsende Komplexität von Sanktionsregimen verlangen die Leitlinien von Finanzinstituten die Einrichtung robuster interner Governance-Strukturen sowie ihre Überwachung. Dazu gehören klare Verantwortlichkeiten auf Vorstandsebene, die Etablierung von Meldewegen sowie Eskalationsstufen und die Integration des Sanktions-Screenings in die allgemeinen AML- und CFT-Systeme.
Institute müssen zudem detaillierte Richtlinien für den Umgang mit eingefrorenen Vermögenswerten, blockierten Transaktionen und der Behebung von Fehlern vorhalten, um sicherzustellen, dass Entscheidungen nachvollziehbar und gut dokumentiert sind.
Wichtige Termine und Fristen
- 30. Dezember 2025: EBA-Leitlinien zu Sanktionen treten in Kraft.
- Ab 2026: Die nationalen zuständigen Behörden (NCAs) beginnen mit der Bewertung der Compliance-Systeme der Institute im Rahmen ihrer Aufsicht.
Ausblick
Aufgrund des Inkrafttretens der EBA-Leitlinien Ende 2025 ist eine zeitnahe Anpassung interner Systeme und der Governance erforderlich. Im Fokus stehen die Überprüfung von Screening- und Eskalationsprozessen sowie die Verankerung der Risikoüberwachung auf Vorstandsebene.
Fazit: Der regulatorische Rahmen für 2026
Das Jahr 2026 markiert eine wichtige Phase für die Regulierung des EU-Zahlungsverkehrs. Mit der IPR-Berichterstattung im April und der Einführung der EUDI-Wallets im November stehen konkrete Umsetzungsfristen an.
PSD3, DAC8 und das AML-Paket zielen darauf ab, die Transparenz und operative Sicherheit zu erhöhen, während die EBA-Leitlinien die Sanktions-Compliance harmonisieren. Für Finanzinstitute und Unternehmen bedeutet dies, dass interne Systeme und Governance-Strukturen überprüft und angepasst werden müssen.
Verbraucher*innen profitieren im Gegenzug von effizienteren und sichereren digitalen Diensten. Insgesamt bilden diese Maßnahmen den Rahmen für ein modernes Finanzökosystem. Eine frühzeitige Vorbereitung stellt sicher, dass regulatorische Anforderungen erfüllt und potenzielle Wettbewerbsvorteile genutzt werden können.
Zahlungsprozesse zukunftssicher aufstellen
Mit der Instant Payments-Verordnung (IPR) werden Echtzeitzahlungen zunehmend zum Standard im EU-Zahlungsverkehr. Als Anbieter von Instant Account-to-Account (A2A)-Zahlungen nutzt Brite Payments die Möglichkeiten des Open Banking, um Transaktionsprozesse zu optimieren.
Sprechen Sie mit unseren Experten, um zu erfahren, wie Sie mit Brite die regulatorischen Hürden meistern und gleichzeitig das Zahlungserlebnis für Ihre Kund*innen optimieren können.